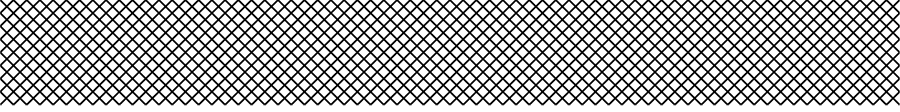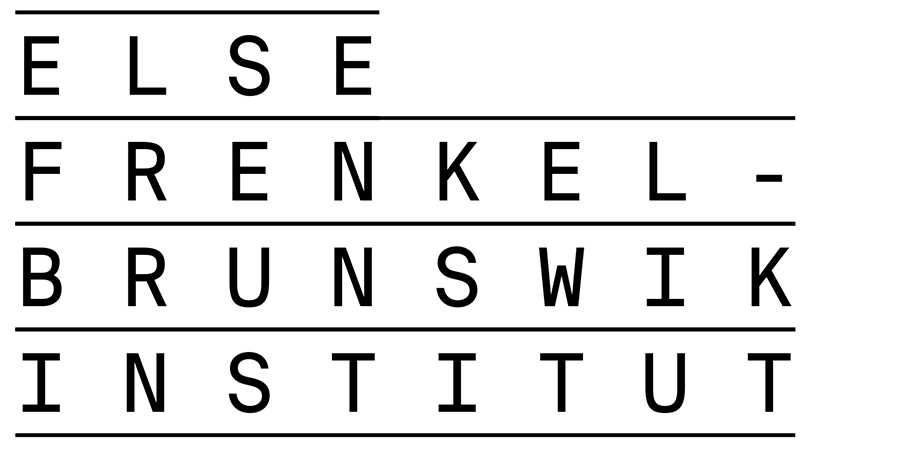KONTAKT
ELSE-FRENKEL-BRUNSWIK-INSTITUT für Demokratieforschung in Sachsen
Universität Leipzig
Ritterstraße 26
04109 LEIPZIG
POSTFACH-NR.: 348003
- Forschungsprogramm
- Projekte
- Dokumentation
- Publikationen
- Veranstaltungen

Projekt in Sachsen
Transformationserleben seit 1989 - Erfahrungen und politisch-gesellschaftliche Deutungsmuster

Das Forschungsprojekt „Transformationserleben seit 1989 - Erfahrungen und politisch-gesellschaftliche Deutungsmuster" untersucht, wie die Wende und die damit einhergehenden Transformationserfahrungen das heutige ostdeutsche Sein und Bewusstsein prägen.
Dass die Wendezeit womöglich bis heute einen Schatten auf die ostdeutschen Bundesländer wirft, ist in den letzten Jahren vermehrt zum Gegenstand öffentlicher, literarischer sowie wissenschaftlicher Debatten geworden. Inhalt der Auseinandersetzung ist die Frage danach, wie die Umbruchserfahrungen um 1989/‘90 und die anschließenden ökonomischen und sozialstaatlichen Transformationen das heutige ostdeutsche Sein und Bewusstsein prägen. Jüngere wissenschaftliche Publikationen verweisen auf ein umstrittenes Erbe von 1989 und die Gegenwart eines Gesellschaftszusammenbruchs, auf eine lange Geschichte der Wende und die Mystifizierung von 1989 (z.B. Leistner/Wohlrab-Sahr 2022). Es besteht weitestgehend Einigkeit darin, dass die Geschehnisse von damals Konsequenzen bis heute haben.
Rechte agitieren heute und berufen sich dabei auf die Wende von damals
Ein Auslöser der Debatten um „den“ Osten waren die Wahlerfolge der AfD sowie Bewegungen wie PEGIDA und Querdenken. Neonazis und extrem rechte Agitator:innen nutzten Bezüge zu 1989 als vermeintlich Traditionslinie eines Systemsturzes schon lange vor PEGIDA, AfD und Querdenken. Die AfD sprang auf den Zug auf. Sie betitelte die Kampagne ihres Landtagswahlkampfes 2019 mit „Der Osten steht auf“, die Wahlplakate trugen den Aufruf „Vollende die Wende“. Doch in den Querdenken-Protesten seit 2020 haben die Bezüge zu „1989“ ihren bisherigen Höhepunkt erreicht (Kalkstein/Dilling, 2024, Kalkstein/Schließer/Dilling 2023).
Die erfolgreiche Gleichsetzung eines „Heute wie damals“ ist nach wie vor unverstanden. Sind PEGIDA & co. tatsächlich Resonanzraum für ‚Wende-Verlierer‘? Die derzeitigen Einschätzungen legen eher Anderes nahe. Denn ostdeutsche Erfahrungswelten und Lebensrealitäten waren in den letzten 30 Jahren in ihrer Vielschichtigkeit und ihren Ambivalenzen kaum medial repräsentiert. Das legen die Zahlen, auf die Oschmann (2023) sich bezieht, eindrücklich frei. Auch empirische Forschung über die Wende- und Transformationsjahre als ambivalenten Erfahrungsraum, in dem neben Zugewinn von Freiheiten und Möglichkeiten auch Verluste ausgehalten und verarbeitet werden mussten, besteht bisher nur rudimentär. Die Soziologin Katarina Warda (2021) geht von unaufgearbeiteter Erfahrung als Nährboden für den „Mythos 1989“ auf den Querdenken-Protesten aus. Nicht die Wende- und Transformationserlebnisse an sich, sondern die Tatsache, dass Teile dieser nicht verarbeitetet wurden, sei die Ursache.
Kontinuität zwischen damaligen Erfahrungen und heutigen Ansichten
Die Frage, warum das Mobilisierungspotenzial der Wendebezüge so erfolgreich anwachsen und durch rechte Mobilisierung nahezu vollständig besetzt werden konnte, bedarf jedoch weiterer systematischer Forschung. Zu ihrer Beantwortung möchte das Forschungsprojekt „Transformationserleben nach 1989 und politisch-gesellschaftliche Deutungsmuster heute“ beitragen. Dazu werden Gruppendiskussionen mit Menschen aus Sachsen geführt, die selbst den Mauerfall und die deutsch-deutsche Vereinigung erlebt haben. Ziel ist es herauszuarbeiten, ob sich narrative sowie emotionale Kontinuitäten zwischen dem Wende- und Transformationserleben und den politisch-gesellschaftlichen Deutungsmustern heute finden lassen. Die Forschungsergebnisse sollen dazu beitragen, gesellschaftliche Konfliktkonstellationen zu symbolisieren und damit auf empirischer Grundlage eine adäquatere Sprache für sie zu finden.
Literatur
Kalkstein, F., Dilling, M., & Schliessler, C. (2023). Heute wie damals? Die sächsische Oberlausitz als Konflikt- und Mobilisierungsraum der Corona-Proteste. In O. Decker, F. Kalkstein, & J. Kiess (Hrsg.), Demokratie in Sachsen. Jahrbuch des Else-Frenkel-Bunswik-Instituts für 2022. (S. 179–200). Leipzig: Edition Überland.
Kalkstein, F., & Dilling, M. (2024). „1989“ als Mythos – Apokalypse als Neuanfang Eine tiefenhermeneutische Fallanalyse der apokalyptischen Narrative und der Wendebezüge auf den Corona-Protesten. ZRex – Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung, 4(2).
Leistner, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2022). Das umstrittene Erbe von 1989. Zur Gegenwart eines Gesellschaftszusammenbruchs. Köln: Böhlau.
Oschmann, D. (2023). Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung: Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet. Berlin: Ullstein.
Warda, Katharina (2021). Friedliche Revolution 2.0.? Mit DDR-Vergleichen wird Stimmung gegen die Pandemiepolitik gemacht. In Heike Kleffner und Matthias Meisner (Hrsg.), Fehlender Mindestabstand. Die Coronakrise und die Netzwerke der Demokratiefeinde (S. 149-157). Freiburg: Herder.